Peter de Mendelssohns Standardwerk über die „Zeitungsstadt Berlin“ ist ins digitale Zeitalter verlängert worden. Ein Klassiker voller Geschichten über Machtträume und unausrottbare Illusionen.
Für Print soll nur eine Nische bleiben
Am Anfang steht ein programmatisches Bekenntnis: „Der Verfasser schreibt nicht als Unbeteiligter. Er ist kein Zeitungswissenschaftler, sondern ein Journalist. Er hat sein ganzes Leben mit Zeitungen und eine Anzahl entscheidender Jahre in Berlin zugebracht.“ Der sich so vorstellt, ist Peter de Mendelssohn (1908 – 1982). Er war Publizist und Romancier, kannte das Tageszeitungsgeschäft und ging wie so viele andere deutsche Juden nach 1933 ins Exil. Nach dem Krieg ist er in die zerstörte Hauptstadt zurückgekommen und hat in verschiedenen Funktionen zum Wiederaufbau beigetragen. Mit „Zeitungsstadt Berlin – Menschen und Mächte in der Deutschen Presse“ verfasste er 1952 eine Monographie, die im Lauf der Jahrzehnte zu einem Standardwerk geworden ist. Für die zweite Auflage hat Mendelssohn das Buch noch selbst um drei Kapitel erweitert und auf den Stand der frühen 1980er Jahre gebracht. Nun hat das Buch ein neuerliches Update erfahren. Mitsamt neuen Vorworten, Nachworten und einem Epilog. Diesen medialen Brückenschlag ins 21. Jahrhundert hat Lutz Hachmeister zusammen mit zwei Co-Autoren unternommen. Als früherer Medienredakteur des „Tagesspiegel“ und langjähriger Grimme-Direktor ist Hachmeister hinlänglich in dem Metier bewandert. „Von der Zeitungsstadt zur Digitalwirtschaft“ ist der Text überschrieben. Die Dystopie einer tendenziell zeitungslosen Hauptstadt scheint auf, auch wenn die Autoren so freundlich sind, für die Printzeitung der Zukunft eine Nische zu reservieren: Sie „entwickelt einen Charme, der dem von Vinylplatten im Musikgeschäft gleicht.“ Aber eins erscheint ihnen ausgemacht: „Die tonangebenden Stimmen der Hauptstadt sind digitale Unternehmungen“. Fragt sich nur welche.
Schon die kurze Zeitspanne von der Wendezeit bis zur Gegenwart zeigt, dass die Halbwertzeit solcher Prognosen nicht überschätzt werden darf. 300 Jahre Berliner Zeitungsgeschichte werden von einer unausrottbaren Illusion begleitet. Der Glaube, über kräftige Investitionen in mediale Erzeugnisse neue Märkte erschließen zu können, darüber zu marktbeherrschender Macht zu kommen und am Ende gar noch dauerhaft politischen Einfluss auszuüben. Wer erinnert sich noch an den britischen Medienmogul Robert Maxwell? Der ließ sich zusammen mit dem Hamburger Gruner + Jahr-Verlag von den phantastischen Auflagen des Berliner Verlags zu DDR-Zeiten blenden, zahlte dafür 300 Millionen Mark an die Treuhand. Mit Erich Böhme installierte man einen Chefredakteur, der versprach, die „Berliner Zeitung“ zur „deutschen“ Washington Post zu machen. Diese teuren Blütenträume aus dem analogen Zeitalter sind ebenso geplatzt wie die verlustreichen „Berliner Seiten“ der FAZ Vergangenheit sind. Und wer erinnert sich – um ein digitales Beispiel zu nennen – noch an DuMonts „Netzzeitung“?
Vielleicht ist dieses Omnipotenzstreben typisch für die historisch verspätete Metropole Berlin. Peter de Mendelssohns ungemein kenntnisreiches, pointiert wie elegant geschriebenes Werk hält historische Beispiele bereit, aus denen Vermessenheit spricht. So wollte ein Verleger namens Reimar Hobbing aus der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ (DAZ) über indirekte staatliche Subventionen eine „Deutsche Times“ machen. Der Mann ist früh gestorben, er hat dieses Ziel nicht mehr erleben können. Sein Nachfolger, der Mischkonzernbesitzer Hugo Stinnes aus Mülheim an der Ruhr, hat nach 1920 einen anderen Weg eingeschlagen. Er investierte selbst, aber nicht, weil er an unabhängigem Journalismus und Meinungen interessiert war. Bei Stinnes, so lautete ein böser Satz, „stand am Anfang das Holz, das verwendet werden sollte.“ Stinnes war ein großer Waldbesitzer; er brauchte Grubenholz für seine Bergwerke; er hatte Sägewerke und schaffte sich im nächsten Schritt eine Papiermühle an. Was lag näher, als jetzt auch noch eine Zeitung herauszugeben? Eine Zeitung, die zwar finanzielle Hilfen benötigte, mit der man aber auch hemmungslos Interessenpolitik machen konnte. Weniger Staat, lautete die ständige Parole der DAZ, mehr Privatisierungen. Politik, so recht nach dem Geschmack des Inflationsgewinnlers Stinnes. Sieht so eine Times aus?
De Mendelssohns Buch ist zwar eine Hommage an die großen liberalen Berliner Zeitungshäuser Mosse und Ullstein, aber der Autor beschäftigt sich auch ausführlich mit den dunklen Seiten der deutschen Zeitungsgeschichte. Dazu gehört von Anfang an ein ausgeprägter staatlicher Kontrollwahn. Der äußerte sich in preußisch-vordemokratischer Zeit in einem in einem rigiden Zensursystem, das die ersten Zeitungen zu öden Verlautbarungsinstrumenten der Obrigkeit machte. Angst vor Kontrollverlust diktierte später auch das Kaiserreich. Als durchsickerte, dass August Scherl, damals der dritte große Player auf dem Berliner Zeitungsmarkt, seinen konservativ ausgerichteten „Berliner Lokalanzeiger“ verkaufen wollte, reagierte die Regierung panisch. Die Vorstellung, dass ein Rudolf Mosse oder Leopold Ullstein den Scherl-Konzern beherrschen könnten, ließ die Regierung Bethmann-Hollweg handeln und Interessenten das Blaue vom Himmel versprechen. Ironie der Geschichte, wie de Mendelssohn nicht ohne Bitterkeit vermerkt: „Ausgerechnet in der jüdischen Hochfinanz fand die Regierung Männer, die bereit waren, Scherl vor dem ‚jüdischen Zugriff’ zu retten.“ Unter Führung des Kölner Bankiers Simon Alfred von Oppenheim etablierte sich eine Art Herren-Club, der den „Deutschen Verlagsverein“ gründete. Die Honoratioren waren als Verleger Stümper, die aber fatalerweise eins bewirkten: Sie eröffneten Alfred Hugenberg die Gelegenheit, beim Zuschussunternehmen Scherl als Retter in der Not aufzutreten. Über Nacht entstand in der Weimarer Republik ein neuer nationalkonservativer Medienkonzern. Hugenberg beherrschte die Kunst der Vernetzung und Vernebelung bis zur Perfektion. Über seine diversen Beteiligungsgesellschaften gewann er eine marktbeherrschende Stellung – auch bei der Provinzpresse. Mit seiner Diffamierungskampagne im „Berliner Zeitungskrieg“ war er aber auch ein Totengräber der demokratischen Presse Deutschlands.
Ist es da ein Trost, dass Totengräber sich auch ihr eigenes Grab schaufeln können? So ist es Hugenberg nach 1933 ergangen. Politisch ausgeschaltet, verlegerisch marginalisiert. Nur die alten Scherl-Blätter blieben ihm. Der große Rest, auch das was von der in den Ullsteins „Rotationssynagogen“ (Goebbels) fabrizierten „Skandalpresse“-Blättern übrig war, wurde von den neuen Machthabern aufgesaugt: „Am Ende dieser Entwicklung besaß Berlin nur noch eine riesige Zeitungsorganisation, aber keine Zeitungen mehr.“ Alles war unter NS-Kontrolle. Alles unter dem weiten Dach des parteieigenen Eher-Verlags und seiner Tarn-Organisationen. Wieder erweist sich de Mendelssohn als sachkundiger Chronist, der die Gleichschaltung der Presse minutiös nachzeichnet, aber auch vermerkt, welches Hauen und Stechen alsbald unter den braunen Presse-Zaren Winkler, Rienhardt, Amann einsetzte. Geschichte wiederholt sich.
Aber nicht immer. Für den 1932 Bankrott gegangenen Mosse-Verlag gar nicht und der verspätete Neustart des Ullstein-Verlags nach dem Zweiten Weltkrieg stand unter keinem günstigen Stern. Unter den Nachfahren der fünf Ullstein-Brüder fand sich keiner, der die Geschäfte in dritter Generation aussichtsreich hätte weiterführen können. Dem früher so kapitalstarken Verlag fehlten die nötigen finanziellen Mittel. Dafür schlug die Stunde des Axel Caesar Springer – und der Verlag nahm eine andere, konservativere Richtung. Heute gehört der Buchverlag, der verdienstvollerweise die Neuauflage des Buch veröffentlicht, zur schwedischen Bonnier-Gruppe. Springer ist auch schon wieder Geschichte, jedenfalls auf diesem Feld.
Nur in einem Punkt lässt sich de Mendelssohn durch seinen Berliner Lokalpatriotismus zu einem unhaltbaren Superlativ hinreißen. Berlin war nicht die „größte Zeitungsstadt der Welt“ – und ist es erst recht nicht mehr. Das föderal zersplitterte Deutschland spiegelte sich auch in seiner historisch gewachsenen, bunten Zeitungslandschaft. Ein „Vossische Zeitung“ oder das „Berliner Tageblatt“ konnten mit der „Frankfurter Zeitung“ und deren weitverzweigtem Korrespondentennetz nicht mithalten. Und: mit unangefochtenen Zeitungsmetropolen wie London oder Paris lässt sich Berlin nicht vergleichen. Dafür hatten die Berliner Blätter zu wenig nationales Gewicht.
Ein Stück weit hat dieses Defizit auch mit einem deutschen Sonderweg zu tun. Die deutschen Zeitungen mochten sich mit Rücksicht auf die Gewohnheiten der Leser weder von der verschnörkelten Fraktur-Drucktype noch vom oft piefig-kleinen Berliner Format trennen. Sie blieben durch die Bank Sklaven einer überholten Form und wirkten besonders im Ausland antiquiert, selbst wenn ihnen Texte mit Weltgeltung steckten. Noch eine Ironie der Geschichte, dass viele in Bedrängnis geratene Qualitätsblätter heute ihr Überleben mit der Rückkehr zum Boulevardformat verbinden.
Michael André
Bild ganz oben: Faksimile | Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung | Berlin | Mosse | 1898-03-04 (Quelle: zefys.staatsbibliothek-berlin.de)
Bild: Ephraim Moses Lilien – Poster for the newspaper Berliner Tageblatt, 1899 (Quelle: Source/Photographer: Die Geschichte der Juden in Deutschland, hrsg. von Arno Herzig & Cay Rademacher (Hamburg 2007), S. 126 | Scan James Steakley | The author died in 1925, so this work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author’s life plus 80 years or less.)
_____
Zeitungsstadt Berlin
(Peter de Mendelssohn, Lust Hachmeister,
Leif Kramp, Stephan Weichert)
Hardcover | Berlin 2017 (Ullstein Verlag)
816 Seiten | 42 Euro
ISBN 9783550081576
- Johannes Willms: Der General. Charles de Gaulle und sein Jahrhundert - 4. November 2019
- Clemens Klünemann: Sigmaringen. Eine andere deutsch-französische Geschichte - 19. September 2019
- Matthias Waechter: Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert - 1. August 2019


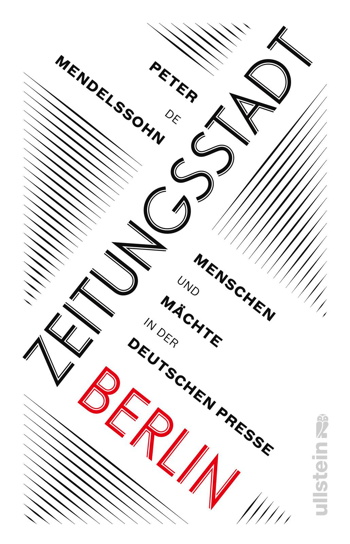
Schreibe einen Kommentar