Nikolaj Gogols 1836 erschienene Erzählung »Die Nase« könnte auch deswegen so heißen, weil sie allen Bemühungen, ihr einen tieferen Sinn zu verleihen, eine lange Nase dreht. Nichts passt da zusammen, ganz im Gegensatz zu Franz Kafkas »Die Verwandlung«, mit der sie oft verglichen wird. Mindestens vier Geschichten sind hier ineinandergeschichtet: die Geschichte vom ungeschickten Barbier, der eines Morgens eine Nase in sein Frühstücksbrot eingebacken findet und versucht, das unliebsame Stück in der Newa zu versenken, was einen Gendarmen auf den Plan ruft; die Geschichte eines Petersburger Beamten in Heiratsnöten, der eines Morgens erwacht und feststellt, dass er keine Nase mehr im Gesicht hat; die Geschichte einer Nase im Rang eines Staatsrats und in prächtiger Kleidung, die, scheint’s, Einkäufe auf dem Newskij-Prospekt erledigt und sich Dreistigkeiten verbittet, bis ihr freilich falsche Papiere zum Verhängnis werden; und die Geschichte der wiedergekehrten Nase, die zuerst nicht im Gesicht halten will und dann plötzlich doch wieder an der richtigen Stelle ist.
Dazu kommen Nebengeschichten wie die vom Mann, der immer nur Brot oder Kaffee zum Frühstück erhielt, aber niemals beides, und die der Frau, die um jeden Preis ihre Tochter verheiraten will. Und zum Schluss folgt noch eine Bemerkung des Autors, die uns vollkommen aus der narrativen Bahn haut: »Man kann sagen, was man will, aber solche Ereignisse kommen vor – selten, aber doch.«
Das alles ist hochpoetischer Blödsinn, zuerst einmal, und deswegen schon der größte Lesespaß, weil »Die Nase« offensichtlich (unter vielem anderen) auch ein Kommentar zur Literaturtheorie ist. Ein Text muss keinen »Sinn ergeben« und schon gar nicht werden, was man in der neudeutschen Diskurssteppe ein »Narrativ« nennt. Natürlich lässt sich die Geschichte auch schwerstfreudianisch lesen, als Kastrationstraum eines Mannes vor der Ehe, ganz zu schweigen von Gogols genauer Beschreibung der sozialen Klassen und ihrer jeweiligen Selbstversicherung und Illusion. Aber von welcher Seite man die Geschichte auch ansieht, stets erzeugen die Sinngebungen ihre unsinnigen Schatten. Oder, ganz anders gesagt: Der Text widerspiegelt die Unmöglichkeit, eine gebrochene Biographie wieder zusammenzufügen.
Bruno Jasieński schrieb diese Geschichte in seiner zu Beginn der dreißiger Jahre in der Sowjetunion entstandenen satirische Erzählung gleichen Namens fort, die jetzt in deutscher Übersetzung im Wiener Verlag Bahoe Books erschienenen ist. Er variiert Gogols Geschichte, nimmt sie als Spielmaterial. Die Erzählung spielt nun im faschistischen Deutschland und handelt von einem Professor der Eugenik, der vergleichenden Rassenkunde und der Rassenpsychologie namens Otto Kallenbruck. Dieser sitzt gerade über den Fahnen für eine Neuauflage seines Werks »Endogene Minusvarianten des Judentums«, das dem Führer so gut gefallen haben soll, dass er bis um zwei Uhr morgens darin las.
Während er das Kapitel über »die typischen Merkmale der semitischen Nase« und die Einflüsse dieser »minusvariantischen Form auf das Seelenleben« überarbeitet, wirft er einen Blick in den Spiegel. Seine Nase hat erschreckenderweise ihre Form geändert, es ist einwandfrei eine »semitische« Nase, gerade so, wie er sie in seinem Buch beschrieben hat. Und von der Verwandlung der Nase scheint auch eine innerer Verwandlung auszugehen. Sogar das Gesicht des Professors, das immer »offen und gutmütig gewesen war, geprägt von reinblütigem germanischen Edelmut, hatte auf einmal einen verschlagenen semitischen Ausdruck angenommen«.
Nun verdächtigt ihn ein enger Freund, eben doch semitische Vorfahren zu haben, schließlich würden sich gewisse rassische Merkmale erst in der zweiten Lebenshälfte offenbaren. Wie der Gogol’sche Mann ohne Nase muss sich Kallenbruck mit der falschen Nase verbergen und in der Öffentlichkeit verhüllen. Der Tiergarten, der zu einem »genealogischen Garten« umfunktioniert worden ist, wo jeder seinen Stammbaum nachverfolgen kann, gibt die Auskunft, dass Kallenbrucks Urgroßvater tatsächlich ein konvertierter Jude namens Isaac gewesen sei.
So rasch von der Seite der Täter auf die der Opfer überführt, wird ihm »freundschaftlich« aufgetragen, möglichst rasch und auf diskrete Art zu »verschwinden«. Auch werde man zu verhindern wissen, dass sich das unreine Blut seiner Kinder weitervererbt, während die arische Ehefrau durchaus noch in der Lage sei, rassisch wertvollen Nachwuchs auszutragen. Kallenbruck weiß, dass er verloren ist: »Das Erbgift des Judentums hat bereits meine deutsche Seele verdorben. Ich bin nicht mehr Herr meiner Sinne. Für mich gibt es keine Rettung mehr! Wenn ich mich nicht selbst umbringe, werden sie das sowieso für mich erledigen … «
So erlebt er am eigenen Leib die psychische und physische Gewalt des Antisemitismus. Und er ist drauf und dran, dem Drängen seines einstigen Freundes nachzugeben und sich selbst zu entsorgen. Doch gerät er, bevor er sich von einer Brücke stürzen kann, in eine Gruppe vor der SA fliehender Juden. Ein Mann rettet ihn, indem er den Zusammengesunkenen auf seine Schulter stemmt. Kallenbruck gerät in eine Rabbinerversammlung, in der gegen das draußen erschallende Horst-Wessel-Lied angesungen wird: »Wir sind zwölf, zwölf sind wir, / die Weisen von Zion! / Heut’ fressen wir die Welt, die fressen wir Heutabend auf.«
Die Rabbiner bieten an, ihm bei seinen Racheplänen behilflich zu sein. Besiegelt wird der Pakt mit Matze, die mit dem Blut von Nationalsozialisten angerührt ist. Kallenbruck hat eine geniale Idee, wie das Regime mit den eigenen Mitteln zu schlagen ist, nämlich indem man das genealogische Register so manipuliert, dass es jedem Nazi mindestens einen jüdischen Vorfahren zuschreibt. Damit das auch richtig wirkt und zu endlosem Streit führt, soll es nach und nach geschehen. Das ist so geschickt ausgedacht, dass die Versammlung den Rassenforscher gleich als 13. Weisen von Zion ehrenhalber aufnehmen will.
Aber dann wird es plötzlich dunkel und alle sind fort. Der Professor ist wieder in seinem Studio, ein Telefonanruf erinnert ihn daran, dass er heute Abend einen Vortrag halten muss: »Die semitische Nase als vererbte Minusvariante des Judentums«. Ein Blick in den Spiegel überzeugt ihn, seine alte »arische« Nase wiederzuhaben. Eine kleine Verunsicherung bleibt. Was würde wohl seine Familie machen, wenn sie von seinen jüdischen Wurzeln erführe? »Fallenlassen«, sagt die Frau. In einen Hinterhalt locken und erschlagen, sagt der Sohn. Man weiß eben, was sich für echte Deutsche gehört.
Professor Kallenbruck hält seinen mit Spannung erwarteten Vortrag über die Nase als vererbte Minusvariante des Judentums, und die Zuhörer und Zuhörerinnen folgen ihm begeistert. Bis er sich kurz einmal an die Nase fasst.
Das vorläufige Ende der Geschichte ist wieder ganz im Sinne Gogols: »Hier endet die sonderbare Geschichte von Professor Kallenbruck. Wie sehr wir uns auch bemühten, wir konnten nichts Zuverlässiges über sein weiteres Schicksal mehr in Erfahrung bringen. Nachrichten aus dem nationalsozialistischen Deutschland flossen in jenen Jahren überaus spärlich. Informationen über Unfälle, die Mitgliedern der herrschenden Partei zustießen, wurden ja bekanntlich strengstens geheim gehalten.«
Allerdings erfahren wir noch, wie hoch der Anteil der Geisteskranken in Deutschland geschätzt wurde. Da man statistisch bewiesen habe, dass die Mehrzahl der Geisteskranken unter »nicht vollwertigen proletarischen Elementen« auftrete, war Professor Kallenbruck sozusagen die Ausnahme. Man griff ihn (so ging das Gerücht) im Tiergarten auf, als er mit einer Hacke die Äste der genealogischen Bäume bearbeitete.
Eine fürchterliche Pointe dieser phantastischen Geschichte besteht darin, dass die irrsinnigsten Rassentheorien und Einschätzungen geistiger Erkrankung keine Erfindungen sind, sondern aus zeitgenössischen »Fachbüchern« und beispielsweise der Zeitschrift für psychiatrische Hygiene zitiert werden. Streng geheim bleiben allerdings jene Untersuchungen, die die Liste der nationalsozialistischen Funktionäre mit jüdischen Vorfahren betreffen, die nach dem Verschwinden des Professors aufgetaucht ist.
Eine gebrochene Biographie, das ist das Mindeste, was man von der Lebensgeschichte des Autors sagen kann: »Bruno Jasieński kam vor 120 Jahren, am 17. Juli 1901, im Städtchen Klimontów im Bezirk Sandomierz zur Welt, der damals zum Russischen Reich gehörte. Er wurde als Pole geboren, mit jüdischen Wurzeln – sein Vater, ein jüdischer Landarzt, hatte eine polnische Adelige geheiratet und war zum Christentum konvertiert –, und verbrachte seine prägenden Kinderjahre nicht nur im heimatlichen Polen, sondern auch in Russland. 1914 wurde der Vater zur Russischen Armee eingezogen. Von 1914 bis 1918 lebte Bruno mit seiner Mutter und den beiden Brüdern in Moskau, bevor er nach dem Ersten Weltkrieg nach Polen zurückkehrte, das 1918 nach 123 Jahren seine Unabhängigkeit wiedererlangt hatte.«
So entnimmt man es dem Nachwort von Vladimir Vertlib, dessen Lebensgeschichte wiederum ganz ähnlich »transkulturell« erscheint. Geboren 1966 in Leningrad wird er (laut Wikipedia) als »ein österreichischer Schriftsteller russisch-jüdischer Herkunft« geführt (als wären wir vor dem genealogischen Geäst des umgewidmeten Tiergartens). Er ist Mitherausgeber der Zwischenwelt. Zeitschrift für Kultur des Exils und des Widerstands, in der »Die Nase« zum ersten Mal auf Deutsch erschien, übersetzt von Elisabeth Namdar, deren Biographie nicht viel weniger Brüche aufweist.
»Die Wahrnehmung jeglicher qualitativen Zuschreibung menschlicher Identität aufgrund von ethnischer Herkunft oder Religion als bizarrer Aberwitz, dem man in letzter Konsequenz nur mit bissiger Satire begegnen kann, hat zweifellos biographische Gründe«, schreibt Vertlib über den Autor (und vielleicht über eine Menge von Menschen wie du und ich). Dessen Kommunismus war wohl nicht zuletzt ein humanistischer Internationalismus, der von einer Überwindung aller religiösen und »rassischen« Gegensätze zu träumen wagte, im Namen einer Idee, die, als sie zur Ideologie geworden war, selber mörderisch wurde.
Nach dem französischen Exil floh Jasieński in die Sowjetunion des Stalinismus, wo er zunächst gefeiert und sogar »Leitungsmitglied im Schriftstellerverband« wurde. Ausgerechnet der »polnischen nationalistischen Verschwörung« wurde er schließlich angeklagt und 1938 hingerichtet. 1955 wurden er und sein Werk »rehabilitiert«, es erschienen sogar »Ausgewählte Werke« in zwei Bänden. Das bekannteste Werk »Ein Mensch wechselt seine Haut« wurde verfilmt, langsam (aber wie zu hoffen ist: sicher) werden seine Bücher auch in Deutschland wieder bekannt. Sie haben eine beklemmende Aktualität.
Wie bei Gogol geht es auch bei Jasieński nicht um einen psychologischen Realismus. Die Menschen entsprechen eher einer Typologie. Sein Professor ist nichts anderes als der typische karrieristische und bornierte, dabei rücksichtslose und zugleich sentimentale Vertreter des deutschen Bürgers im Faschismus, der den Bruch in seiner Biographie durch ein so einfaches Signal wie eine falsche Nase selbst nie versteht. Es ist ein Monstrum, das von anderen Monstren umgeben ist (und besonders monströs ist seine eigene Familie).
Die Ähnlichkeiten zur Gogol’schen »Nase« sind auf den ersten Blick eher oberflächlich. Denn Jasieński vollführt eine geradezu wahnwitzige Engführung seines Themas von einem Täter, der unbewusst Züge seiner Opfer annimmt und dadurch zu einem Opfer zweiten Grades wird: Opfer der eigenen ideologischen Konstruktion. Allerdings könnte man (hierin Vladimir Vertlibs Auffassung nicht vollständig folgend) durchaus eine weitere, tiefergehende Verwandtschaft sehen. In beiden Fällen ist die Nase (beziehungsweise deren Verwandlung oder Verschwinden) Ausdruck einer enormen Identitätsfurcht.
Es ist, in der psychoanalytischen Deutung, eben die Furcht vor der »Entmannung«, die bei Gogols Kowaljow in der drohenden Ehe, bei Jasieński indes in einer offensichtlichen, berechtigten Eifersucht des Professors Kallenbruck veranschaulicht wird. In beiden Fällen freilich ist die bedrohte Männlichkeit zugleich bedrohte soziale Identität. Und in beiden Fällen wird diese Identität durch ein System erzeugt und »kontrolliert«, dem der Protagonist bedingungslos folgt. Es geht also viel weniger um ein Prinzip der »gespaltenen Persönlichkeit« als um ein Auseinanderbrechen von innerer und äußerer »Identität«. Womit das absolute Reizwort unserer Tage gefallen ist.
Gerade das macht die beiden Texte erschreckend aktuell. Ein einziges Attribut wird zum Ausweis der Identität und der Zugehörigkeit und zugleich zur einzigen raison d’être. Ohne Nase beziehungsweise mit der falschen Nase ist der Mensch gar nicht lebensfähig. Die Nase Kowaljows ist der arroganteste und eitelste der Akteure; er hat sie offensichtlich »zu hoch getragen«; die Nase von Kallenbruck scheint sein Seelenleben zu bestimmen, als würde er erst durch sie »verschlagen« und »rachsüchtig«. Beide Erzählungen folgen nicht nur der Logik der satirischen Metapher, sondern zugleich der Logik des Traums, sie spielen ständig mit der Möglichkeit des Aufwachens, verwerfen aber die simple Lösung des »Es war alles nur ein Traum«. Wirklichkeit und Traum zersetzen einander, ganz so, wie Ideologie und Leben einander zersetzen.
Die Verwandlungen sind mithin beide märchenhafte Strafen eben für den Unterschied, den man mit ihnen konstruierte. Und dabei geht es vielleicht um eine weitere Spiegelung oder Negation der zweiten Nase in Bezug zur ersten. Die Abspaltung geschieht nun im Inneren, aus dem Verschwinden ist ein Zuviel geworden, und aus der Flucht der Nase wird eine Besetzung. Der Professor, der sich selbst beobachtet, muss erkennen, dass er schon »wie ein Jude denkt«, aber eben darin liegt seine Verkennung. Der Rassismus ist eine Projektion, genau wie der Autoritarismus, deren grausigste Konsequenz er ist. Die Nase als herausragender Teil der Person ist da nur besonders exponiert.
Die »abgespaltene« Identität der Nasen scheint eine Rache des Unbewussten an der sozialen Zurichtung, und beide Male, könnte man sagen, bietet sie (die Nase, die sich unbotmäßig und verräterisch verhält) eine Möglichkeit für das Bewusstsein an: Wenn nur der Träumende seinen Traum verstünde, dann könnte er vielleicht seine Lehre daraus ziehen. Aber so einfach ist es nicht, glücklicherweise für die Literatur, unglücklicherweise für die Wirklichkeit.
Die böse Paradoxie indes ist, dass offenbar ohne die Nase erst recht nicht mehr vernünftig zu denken ist. Bei Jasieński führt sie allenfalls kurz in einen Rachetraum, der aus der rassistischen Projektion der »Weisen von Zion« entsteht. Weder zur Vernunft noch zur Moral ist dieser Professor zu bringen, nicht einmal dadurch, dass er eine Lebensrettung erfährt. Am Ende will er (wenn er es denn ist, was nur als Gerücht erscheint) als »Verrückter« die Genealogie selbst zerhacken, wenn nicht die Wurzel, so das Geäst allen Übels.
Übrigens gleicht Jasieńskis Text auch hierin dem Gogol’schen Vorbild, dass es durchaus Abzweigungen und Möglichkeiten für die Protagonisten gäbe, die zu ganz anderen Ergebnissen führen würden. Was, wenn Kowaljows Nase sich konsequent geweigert hätte, in dessen Gesicht zurückzukehren, was, wenn Professor Kallenbruck seine neue »Identität« angenommen hätte? Eine Geschichte, die aus lauter anderen, möglichen Geschichten besteht – und die trotzdem genau ins Zentrum trifft, nämlich die Entsprechung eines äußeren Attributs und einer inneren Verfassung, die von einer Gesellschaft kontrolliert werden, die wiederum ohne diese Entsprechung nicht funktionieren würde.
»Beide ›Nasen‹, die von 1836 und die von 1936, setzen sich bitter und satirisch mit Regimen und Gesellschaftsmodellen auseinander, die auf Lügen, Illusionen und dem Fehlen echter Menschlichkeit basieren«, schreibt Vertlib im Vorwort. Und eben: Die beiden sind nicht unabhängig voneinander zu denken.
Aber auch darin liegt die dialektische Negation. Der Schrecken bei Gogol liegt darin, dass nach der kurzen Disruption alles wieder genauso weitergeht wie vorher, während die Nase bei Jasieński seinem Protagonisten keinen Ausweg lässt.
Die satirische Qualität zeigt sich in der Mischung aus kleinbürgerlicher »Gemütlichkeit«, pseudowissenschaftlicher Systematik und schlichter Brutalität des Professors. Dass diese Mischung nicht auf die historische Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland beschränkt ist, muss nicht extra erwähnt werden. Man kann nur vermuten, wie sehr der Umstand, dass sich stalinistische Funktionäre darin erkannt haben, dazu beigetragen hat, den Autor der zweiten »Nase« ermorden zu lassen.
Die beiden Erzählungen aus den vergangenen Jahrhunderten mögen helfen, unter die Oberfläche von Antisemitismus und Rechtsextremismus zu sehen, nämlich dergestalt, dass noch hinter der Rationalisierung und Sozialisierung der Mördersysteme ein Element der Identifikation lauert, das die gebrochenen Biographien aller Beteiligten kennzeichnet (denn auch Gogol war ein Getriebener und Verzweifelter, der es nicht aushielt im eigenen Land, und anderswo auch nicht). Menschen mit gebrochener Biographie in der äußeren Welt beschreiben Menschen, die an der Verdrängung ihrer inneren Gebrochenheit zugrunde gehen. Die gebrochene Biographie führt die einen hinaus und zur utopischen Idee der Welt als Heimat der Menschen. Meistens wird die Hoffnung enttäuscht. Aber es gibt eine andere Form der gebrochenen Biographie, die nach innen führt. Es ist ein Bruch der Identität im klassischen Sinne (der Einheit mit sich selbst), der unter den Bedingungen in den »Nasen«-Erzählungen zu einer paranoiden Reaktion und zu einem unheilbar gebrochenen Selbst- und Weltbild führt.
Dieselben paranoiden und gewalttätigen Schübe wiederholen sich auch heutzutage. 200 Jahre nach Gogol und knapp 90 Jahre nach Jasieński.
Es wird also vielleicht Zeit für eine dritte Nase.
Georg Seeßlen | Jungle World | 24.06.2021
________
Aus dem Russischen von Elisabeth Namdar-Pucher
Bahoe Books, Wien 2021
120 Seiten, 16 Euro
- Zum Tod von David Lynch: Er wusste, wie man den Horizont verschiebt - 21. Januar 2025
- MISCHPOKE II - 4. März 2024
- Bruno Jasieński: Die Nase - 27. Juli 2021
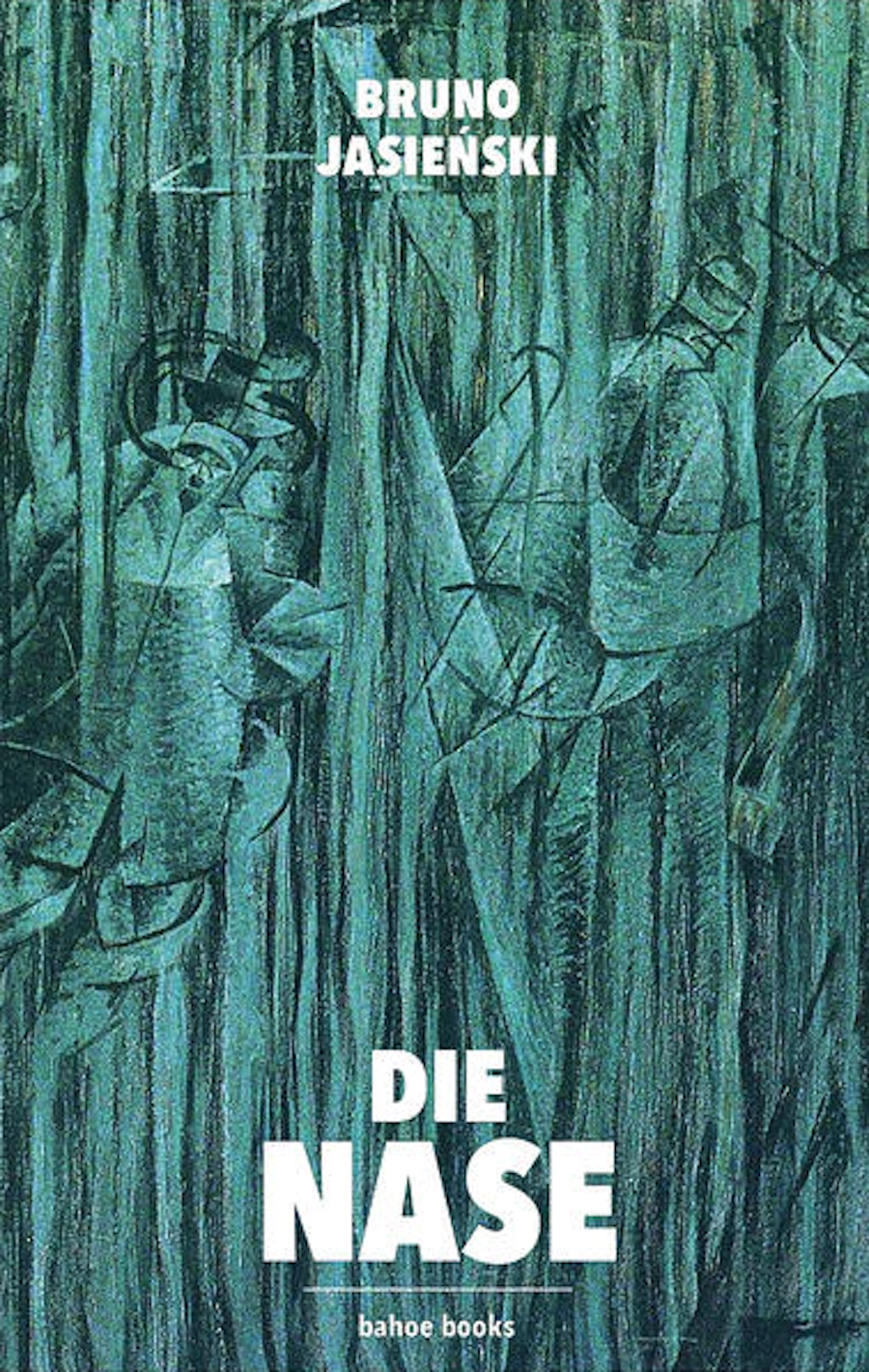
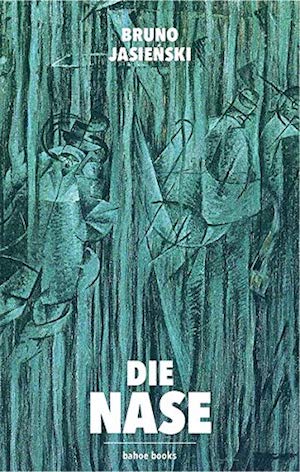
Schreibe einen Kommentar